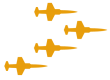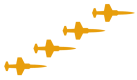Im Land der Raketenmänner
Um mit der Flugzeugtechnik mitzuhalten brauchten Schleudersitze mehr Schub - es wurde noch explosiver
- Kai Ortmann
- 14. Juli 2021
Das Grundproblem – wie bekomme ich den Piloten aus dem Cockpit, ohne das er lebenswichtige Körperteile verliert – hatten die Konstrukteure von Schleudersitzen gelöst. Aber wie bekam man die Insassen hoch genug, um ihnen auch bei Unfällen am Boden eine Chance zu geben? Mehr Schwarzpulver in die Sitzkartuschen verbot sich von selbst, irgendwann macht auch die stärkste Wirbelsäule schlapp. Die Lösung: Raketen. Aber auch deren Verwendung war nicht ohne Tücken. Teil 2 der Serie über die Entwicklung der Schleudersitze.
Bei Notfällen am Boden oder in unmittelbarer Bodennähe hatten die Piloten der ersten und teilweise auch der zweiten Generation düsengetriebener Kampfflugzeuge ein Problem. Denn sie saßen zwar auf Schleudersitzen, die nützten ihnen aber so tief unten nichts. Auch wenn sie aus der Maschine waren, der Fallschirm würde nicht aufgehen, bevor sie selbst Höhe Null erreichten. Um dieses Problem zu lösen brauchte es findige Köpfe, denn die Ingenieure konnten nicht einfach mehr Wucht in den Ausschussvorgang packen. Schließlich sollte der Pilot keine permanenten Schäden erleiden, selbst wenn Verletzungen in Kauf genommen wurden.
Raketen als Lebensretter
Die Lösung lag in einer zweiten Antriebsstufe für den Sitz. Unter dem Sitzboden wurde ein Raketenpack montiert, das zu einem vordefinierten Zeitpunkt während des Ausschussprozesses zündete. Die Brenndauer liegt heute meist irgendwo im Bereich einer halben Sekunde, aber die reicht aus, um selbst bei Geschwindigkeit Null in Höhen zu gelangen, bei denen der Fallschirm etwas nützt. Erstes Modell mit Raketensitz war die Convair F-102 Delta Dagger, ein Höhenjäger der U.S. Air Force, für den sogar die Bewaffnung mit kleinen taktischen Atomwaffen vorgesehen war. Der dort eingebaute Sitz hatte allerdings einen miserablen Ruf, weil er dazu neigte zu taumeln, sobald die Raketen ungleichmäßig abbrannten. Was fast immer der Fall war. Colonel Jack Broughton, der eine F-102-Staffel kommandiert, schrieb in seiner Biographie, dass etwa 70 Prozent der Ausschüsse tödlich endeten. Dass die Jungs überhaupt noch in die Maschinen stiegen verdient Bewunderung.
Ungewollt im Rampenlicht
Heute ist Martin-Baker, eben jenes britische Unternehmen aus Higher Denham, Weltmarktführer im Bereich Schleudersitztechnologie. Mit Stand 14. Juli 2021 haben die Sitze der Briten 7.650 Piloten das Leben gerettet. Wer die Produkte des Hauses Live nutzen muss, bekommt eine Krawattennadel samt zugehöriger Krawatte, einen schicken Pin fürs Jacket-Revers und die Chance auf eine Mitgliedschaft in einem der exklusivsten Clubs weltweit, dem Ejection Tie Club. Aufnahmevoraussetzung: Mindestens einmal mit einem Martin-Baker-Sitz ausgestiegen sein.
Einzige Konkurrenz der Briten in der westlichen Hemisphäre ist Raytheon-Collins mit der ACES-Reihe (Advanced Concept Ejection Seat). Der ACES II ist (noch) der am weitesten verbreitete Sitz in der USAF. Dass die Briten das F-35-Programm mit ihrem Mk. 16 ausrüsten war allerdings ein schwerer Schlag für die Amerikaner aus Colorado Springs. Bis zu einem gewissen Teil sind sie Opfer der Marktbreite, die in den Anfangsjahren der Schleudersutztechnologie in den USA herrschte. Fast jeder Flugzeughersteller baute seine eigenen Sitze oder hatte einen eigenen, festen Zulieferer. Als Resultat kochte jeder sein Süppchen, die großen Techniksprünge kamen von der anderen Seite des Atlantiks. Die Presse, insbesondere die Europäische, tat ein Übriges, um die Aufmerksamkeit auf den Hersteller aus dem Vereinigten Königreich zu lenken.
Sitzwechsel
Denn die griff natürlich die Tatsache auf, dass die deutsche Luftwaffe mitten in der normalen Nutzungszeit dem Starfightercockpit einen neuen Bürostuhl verpasste. Der bisher verbaute US-Sitz vom Typ C-2 wurde durch den Martin-Baker GQ7 ersetzt, was sich in kürzester Zeit bemerkbar machte. Nur wenige Monate nach dem Umbau beispielsweise hatte auf dem deutschen Fliegerhorst Hopsten einer der Piloten Probleme beim Start. In der Folge rasierte er sich etwas unglücklich einen Teil des Hauptfahrwerks ab, als die Maschine die Einhausung der Fanganlage überrollte. Er aktivierte seinen – jetzt englischen – Clubsessel und kam mit ein paar Prellungen und Verletzungen von der Landung davon. Wäre er sitzen geblieben hätte die Feuerwehr nur noch seine Leiche bergen können. Und mit dem ursprünglichen C-2-Sitz wäre er vermutlich nicht hoch genug für eine ausreichende Schirmöffnung gekommen.


Tücken des Objekts
Dass die Bilanz des C-2 im deutschen Starfighter so miserabel ausfällt liegt noch nicht einmal unbedingt alleine am Sitz. Auch die dazu verwendeten Fallschirme hatten ihren Anteil. Die F-104 war das erste Serienflugzeug auf der Welt, das im Horizontalflug zweifache Schallgeschwindigkeit erreichte. Von grundsätzlicheren Fragen der Überlebbarkeit eines Ausschusses bei der Geschwindigkeit abgesehen, wäre eine sofortige, unverzögerte Kappenöffnung für den daran hängenden Menschen nicht zu überleben. Von der Reißfestigkeit der Kappe ganz zu schweigen. Also behalfen sich die zuständigen Ingenieure mit einem inneren Packsack, der die Schirmöffnung verzögern sollte, bis genügend Geschwindigkeit abgebaut war. In den Höhen, für die die 104 gebaut wurde, war das unproblematisch. Aber in Deutschland wurde die Maschine ganz anders eingesetzt, als Jabo, in Bodennähe. Und da ist jeder Sekundenbruchteil kostbar. Auch neigte das Gesamtsystem zum Taumeln, saß der Pilot beim Ausschuss nicht ganz gerade. Den Todesstoß versetzte dem C-2-Sitz ein Fall, bei dem der Pilot kontrolliert 1.000 Fuß über dem Platz seinen Starfighter verließ und trotzdem ums Leben kam. Spätestens da war dem damaligen Luftwaffeninspekteur Johannes Steinhoff klar, dass die Piloten das Vertrauen in ihr Gerät verloren hatten. Übrigens: Die Kanadier setzten von der Einführung bis zum Nutzungsende 1985 auf den C-2. Allerdings mit einer Reihe von Verbesserungen wie doppelten Gurten zur Sitz-Mann-Trennung oder einer Hilfsrakete zur Schirmöffnung.

Digitalisierung auch beim Rettungsgerät
Dem Grundprinzip „Kanonenschlag-Rakete-Fallschirm“ folgen im Prinzip alle modernen Schleudersitze. Dennoch hat sich seit den 60er Jahren einiges getan. Die Tücke steckt auch hier, wie meistens, im Detail. So ziehen moderne Sitze den Flugzeugführer grundsätzlich durch den Schirm aus dem Sitz und lösen so das Problem der Sitz-Mann-Trennung. In doppelsitzigen Maschinen wie dem deutschen Tornado oder der amerikanischen Strike Eagle sind Ausschussfolgesysteme (engl. command ejection) verbaut, so dass auch der hinten sitzende Waffensystemoffizier seinen Piloten aus der Maschine befördern kann. Zwischen einem und drei Stabilisierungsschirme verhindern, dass der Sitz in der Luft unkontrolliert taumelt. Bei russischen Systemen kommen für den gleichen Zweck Teleskopstangen zum Einsatz. Der aktuell gängigste Sitz in Maschinen russischer Produktion, der K-36, fährt beim Ausschuss einen Windabweiser zwischen den Oberschenkeln des Piloten hoch, der dessen Oberkörper bei Hochgeschwindigkeitsausstiegen vor den schlimmsten Folgen des Fahrtwindes schützen soll.
Kurze Randnotiz: Wie gut die Sitze aus der Sowjetunion wirklich waren, demonstrierte der Mikojan-Werkstestpilot Anatoly Kvochur etwas unfreiwillig auf dem Pariser Aerosalon 1989: Die nagelneue Mig-29 das dritte Mal im Westen vorführend, erwischte er bei einem High-Alpha-Pass, also einem langsamen Vorbeiflug mit extrem hohem Anstellwinkel, einen Vogel. Das rechte Triebwerk quittierte daraufhin den Dienst. In kaum 100 Metern Höhe kippe die Fulcrum über die Fläche ab, Kvochur stieg aus und landete nahezu zeitgleich mit seiner Maschine auf dem Boden. Der große Unterschied: Während die Mig nur noch Schrottwert hatte, konnte Kvochur wieder ins Cockpit steigen, mehr als ein paar Blessuren von der Landung trug er nicht davon. Den Ingenieuren von Martin-Baker fiel vor Staunen der Rechenschieber aus der Hand, mit dem damals üblichen Mk. 10 hätte der Pilot mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überlebt.
Heute verbauen alle Hersteller sogenannte Sequenzer, kleine elektronische Helferlein, die ständig die wichtigsten Informationen zur Lage der Maschine im Raum sammeln und auswerten – also Höhe, Geschwindigkeit, Anstell- und Rollwinkel sowie Sink- respektive Steigrate. Löst der Pilot den Sitz aus, entscheidet der Sequenzer blitzschnell, welcher Mode, also welche Ereignisabfolge am Sitz die beste ist. Westliche Sitze haben aktuell drei verschiedene Modi, Low and Fast, Low and Slow oder High. Wobei die Handbücher nur die römischen Ziffern I bis III verwenden. Auch hat sich einiges bei der Stabilisierung getan, so dass der eben erwähnte Anatoly Kvochur heute wohl auch mit Martin-Baker-Sitzen eine Chance hätte. Praktisch demonstriert hat das Captain Brian Bews, Royal Canadian Air Force, am Trainingstag der Alberta International Air Show 2010. In einem Manöver, das dem von Kvochur stark ähnelt, versagte auch bei Bews das rechte Triebwerk der CF-18. Der Rettungsausschuss erfolgte gefühlt fast später als 21 Jahre vorher in Paris, aber der NACES-Sitz (Navy Air Crew Common Ejection System, ein modifizierter Martin-Baker Mk. 12) rettete ihm das Leben. Warum es trotzdem auch einmal tragisch enden kann, wenn der Schleudersitz zündet, und ein paar andere Geschichten und Fakten rund um den „Bang Seat“ gibt’s im dritten Teil der Serie.
Captain Brian Bews RCAF und sein bemerkenswerter zweiter Geburtstag – 23. Juli 2010, Lethbridge Airport, Alberta, Kanada.
Die Geschichte des Schleudersitzes im Video – Teil 2